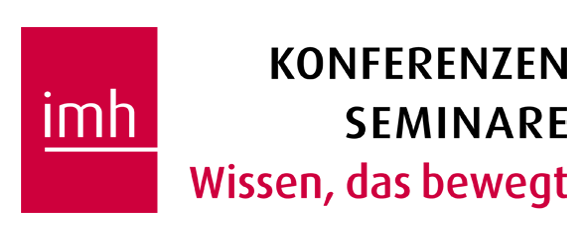09:00 – 14:00
Aktuelle Rechtsprechung der Unionsgerichte & Auswirkungen auf die nationale Beihilfenpraxis
Rechtliche Grundlagen: Ausnahmen, Verbote und Anwendungsbereich
- Relevante Tatbestandsmerkmale für das Vorliegen einer Beihilfe gem. Art 107 (1) AEUV
- Ausnahmen vom generellen Beihilfenverbot
- Anwendungsbereich des EU-Beihilfenrechts
- Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission
Aktualisierung der beihilferechtlichen Grundlagen
- Allgemeine Gruppenfreistellungs-VO (AGVO), Novelle 2023: Neue Beihilfemöglichkeiten für den Transformationsprozess
- De minimis VO, Novelle 2023
- Mitteilung zum Beihilfenbegriff (NoA)
Brisante Förderfälle, beihilfenrechtliche Urteile und Entscheidungspraxis der Europäischen Kommission
Abgrenzung wirtschaftlicher und nicht-wirtschaftlicher Tätigkeiten
Rechtliche Absicherung | Praktische Unterscheidungsmerkmale | Prüfraster
Unionsrechtliche Rahmenbedingungen: Judikatur zur Unterscheidung wirtschaftlicher und nicht-wirtschaftlicher Tätigkeiten
- Welche beihilfenrechtliche Auswirkung hat die Finanzierung wirtschaftlich und nicht-wirtschaftlicher Einrichtungen?
- Rechtliche Abgrenzung und Anforderungen der EU
Ihre Expertin:
MR Mag. Sibylle Summer, Stv. Ltr. Abt. V/4, Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
14:00 – 17:00
Fokus Forschungseinrichtungen
Beihilferecht für Forschungseinrichtungen
- Rechtsgrundlagen: Unionsrahmen, AGVO, De-minimis
- Tätigkeiten von Forschungseinrichtungen aus beihilferechtlicher Sicht
- Die Forschungseinrichtung als Unternehmen: Beihilfeempfänger vs. Beihilfevermittler
- Wirksame Zusammenarbeit vs. Auftragsforschung
- Die mittelbare Beihilfe: Wann erhält mein Partner einen Vorteil?
- Richtige Projekt- und Vertragsgestaltung, Umgang mit Projektergebnissen und Ergebnisverwertung
- Konsequenzen für das Rechnungswesen: Kosten- und Preiskalkulation, Umgang mit Erlösen
Ihr Experte:
MMag. Dr. Stefan Huber, LL.M., Partner, CERHA HEMPEL Rechtsanwälte GmbH
09:00 – 12:00
Trennungsrechnung: Umfang | Umsatzsteuerrecht | Rechnungswesen
Anforderung an die Trennungsrechnung
- Wann ist eine Trennungsrechnung iSd EU-Beihilferechts zu implementieren?
- Welche grundsätzlichen Anforderungen an eine Trennungsrechnung können dem EU-Beihilferecht entnommen werden?
- Ergeben sich diesbezüglich Ausnahmen?
- Beihilferecht vs. Umsatzsteuerrecht
- Das Unternehmen/die wirtschaftliche Tätigkeit in Beihilferecht und Umsatzsteuerrecht
- Vorsteuerabzug und Fragen in der Praxis
Herausforderungen im Rechnungswesen
- Darstellung wirtschaftliche und nicht-wirtschaftliche Tätigkeiten
- Ermittlung von Personalkosten, Consumables, Infrastrukturnutzung
- Ermittlung der Gemeinkostenumlage/-zuschläge
- Ausschluss der Quersubventionierung: Marktpreis, Vollkosten und Grenzkosten
13:00 – 15:30
Fallbeispiele
Erarbeiten Sie anhand praktischer Übungsfälle Lösungsansätze für die beihilfenkonforme Abwicklung speziell im F&E&I Bereich.
Praktische Übung zu Abgrenzungsfragen
- Praktische Unterscheidungsmerkmale wirtschaftlicher und nicht-wirtschaftlicher Tätigkeiten
- Quantitative und qualitative Prüfkriterien: 20% Schwelle
Praktische Übung zur Trennungsrechnung
- Gliederung und Aufbau einer Trennungsrechnung
Ihr Experte:
Dr. Peter Thyri, LL.M.(NYU), LL.M.(DUK), PETER THYRI Competition Counseling & Research
16:00 – 17:00
Kontrolle der Trennungsrechnung durch den Fördergeber
Aktueller Prüfmaßstab der Förderstellen und Prüfinstanzen bei EU-kofinanzierten Projekten
- Voraussetzungen und Anforderungen an eine Trennungsrechnung bei der Vergabe von EFRE-Förderungen
- Darstellung der Finanzierung als zentrale Komponente (Abgrenzung zu Liquidität, Eigenmitteln, Basisfinanzierung, Globalbudgets etc.)
- Systemprüfung: Finanzielle Sicherheit durch Nachweis und Prüfung der Trennungsrechnung vor Projektbeginn
- Vorhabensprüfung: Ausschluss unzulässiger Quersubventionierung/Überfinanzierung nach der Projektdurchführung
- Konkrete Anwendungsfälle bei Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen
Ihr Experte:
Dipl.-Bw. (FH) Christian Gnatzy, Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF)
imh-Vorab-Service: Maximieren Sie den Nutzen des Seminars!
Holen Sie das Beste aus dem imh-Seminar heraus, indem Sie die Inhalte nach Ihren eigenen Bedürfnissen gestalten. Schicken Sie uns hierfür einfach Ihre Fragen vorab an gabrijela.popovic@imh.at, und wir leiten sie direkt und anonymisiert an unsere erfahrenen Vortragenden weiter, die vor Ort direkt darauf eingehen werden.